
Wie konnte es zum Erstarken der Terroristen des „Islamischen Staates“ kommen? Es ist eine Mär, dass die Spannungen im Irak vor allem ein Produkt westlicher Interventionen sind. Ein Essay.

Wie konnte es zum Erstarken der Terroristen des „Islamischen Staates“ kommen? Es ist eine Mär, dass die Spannungen im Irak vor allem ein Produkt westlicher Interventionen sind. Ein Essay.

In mittelalterlichen Ritterschlachten war ein Ziel, möglichst niemanden zu töten, denn Tote waren ein schlechtes Geschäft. Später verdrängte die Ideologie die Ökonomie als Kriegsräson. Und heute ist auf nichts mehr Verlass.
Sie erfand die Mumins: An diesem Sonnabend wäre die finnische Autorin, Malerin und Comiczeichnerin Tove Jansson 100 Jahre alt geworden.

Die aktuelle Krise in den Beziehungen Deutschlands zu Russland stört Egon Bahr sehr. Der SPD-Politiker hat einst mit Moskau den Entspannungsvertrag ausgehandelt. Im Interview fordert er, den Faden nach Moskau nicht abreißen zu lassen.

Er schafft das, was allen Schreibern gelingen sollte: Vom ganz Kleinen auf das ganz Große zu verweisen: „Die Büchse der Pandora“ heißt Jörn Leonhards in diesem März erschienenes Buch, in dem er auf über tausend Seiten den Ersten Weltkrieg als europäische Gesellschaftsgeschichte erzählt. Auf den Titel kam der Historiker über eine winzige Randnotiz dieser alles umwälzenden Katastrophe: Die Kinder von Katia und Thomas Mann, so erklärt er in einem Interview mit der Zeit, hätten am 2.
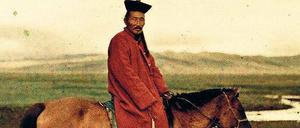
Der Berliner Martin-Gropius-Bau zeigt sensationelle Farbfotografien aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. In Auftrag gegeben wurden sie von einem französische Mäzen, der ein Archiv des Planeten anlegen wollte.

Die Umweltschutzorganisation Robin Wood kritisiert, dass zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg Ballons aufsteigen. Das sei Krieg gegen die Tierwelt. Dazu eine Glosse.

Nichtlesen ist eher die Regel als die Ausnahme: Digitale Techniken machen das Leseverhalten transparent - und entlarven so den Typus des Bildungsbürgers. Eine Kolumne.

Sind sie Helden oder Versager, die beiden Generäle, die jene schicksalshafte Schlacht an der Marne im Spätsommer 1914 für Deutschland führten? Eine Suche nach ihren Spuren, in München und Frankreich.

Die Propagandastele: Vom Glockenturm am Olympiastadion blickt man in grüne Fernen und historische Abgründe.

Wegen Renovierung geschlossen: Für mindestens fünf Jahre wird der Pergamon-Altar nicht zu sehen sein. Da bleibt nur eins: Hingehen, bevor es zu spät ist – doch bitte mit offenen Augen!

Donnerworte und Kriegsgebete: Wie im Fieber taumelten die Berliner durch den Tag, an dem der Erste Weltkrieg begann. Noch heute kann man sich die Rede Wilhelms II. anhören. Dabei hat er sie niemals gehalten.

Gemeinsam gedachten die Präsidenten von Frankreich und Deutschland am Sonntag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Joachim Gauck betonte, das gemeinsame Europa sei „keine Laune der Geschichte“, sondern vielmehr die „Institution gewordene Lehre aus der Geschichte“.

Die SPD im Reichstag wusste, wohin der Weg ging. Trotzdem stimmte sie am 4. August 1914 den Kriegskrediten zu. Hätte sie, wenn sie anders gehandelt hätte, die moralische Kraft für die Zeit nach 1918 gehabt? Ein Kommentar.
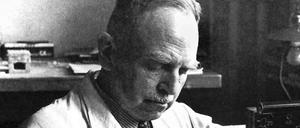
Otto Hahn war Nobelpreisträger und Gegner der Atombewaffnung. Im Ersten Weltkrieg aber gehörte er zu den Wissenschaftlern, die den Einsatz von Giftgas vorbereiteten und sogar lenkten.

Durchgedrehte Groteske über die deutsche U-Boot-Begeisterung: „U-713 oder Die Unglücksritter“ von Pierre Mac Orlan aus dem Jahr 1917 ist eine großartige Entdeckung.
Eine Flaschenpost aus dem Schwielowsee gibt Historikern derzeit Rätsel auf

Wo geht’s zur Front? Bei den Festspielen enttäuschen die Inszenierungen von Karl Kraus' „Die letzten Tage der Menschheit“ und Katie Mitchells „The Forbidden Zone“.

Zehntausende Deutsche und Franzosen starben im Ersten Weltkrieg am Hartmannsweilerkopf im Elsass. Am Sonntag gedenken beide Staatspräsidenten dort gemeinsam der Toten.

Kriege sind nie zwangsläufig, aber der Friede ist keineswegs sicher, meint Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Eine Betrachtung der aktuellen Lage anlässlich des 100.Jahrestags des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. Ein Kommentar.
Die Potsdamer sind im Urlaub und die Urlauber in Potsdam – die Touristen-Hochsaison hat unverkennbar begonnen. Viele Reisende entdecken die Stadt am liebsten individuell
Die Kritik an Israels Vorgehen in Gaza vergisst oft: Der Westen führt nicht anders Krieg. Ein Kommentar

Deutschland ist wider Willen wieder an Kriegen beteiligt. Trotzdem wiederholen sich 1914 und 1939 nicht mehr. Ein Kommentar.

Aktivisten überklebten am 20. Juli Schilder in Tempelhof und Charlottenburg – als Aktion gegen Militarismus. Die betroffenen Bezirke halten die Kritik für unangebracht.
Im Neuen Palais wurde 1914 der Kriegszustand verhängt. Ab heute erinnert eine Ausstellung daran

Verschwörungstheoretiker munkeln gern, dass die Mondlandung nur inszeniert war. Tatsächlich entstanden viele Ideen für die Apollo-Mission beim Film.

Die deutschen Protestanten haben 1914 Kriegsaufrufe von der Kanzel verlesen. Heute empfinden die evangelischen Kirchenfunktionäre "Scham" darüber, dass ihre Vorgänger damals nicht für den Frieden geworben haben.

Als im Juli 1914 Krieg droht, sind sich Europas Arbeiterparteien einig: nicht mit uns! Anfang August stimmt die SPD dann doch Kriegskrediten zu. Was ist da passiert?

Spionage ist ein uraltes Geschäft. Auch vor dem Ersten Weltkrieg spielte sie eine Rolle. Aber taugt sie auch etwas? Oder ist sie einfach nur sinnlos?
Eberhard Schmidt stellt seine Biografie über Kurt von Plettenberg, einen der Attentäter des 20. Juli, in der Villa Quandt vor

Die Historikerin Annika Mombauer im Gespräch über deutschen Hochmut, die Julikrise des Jahres 1914 und die Lehren aus dem Ersten Weltkrieg.

Der Nahe Osten steht vor einer grundlegenden Neuordnung. Die Isis-Krieger wollen ein muslimisches Großreich wie zu Mohammeds Zeiten errichten - mit einem mörderischen Scharia-Regime. Und kaum jemand kann sie stoppen.

Wie Soldaten aus Potsdam in den Ersten Weltkrieg zogen, erklärte Historiker Rainer Lambrecht

Von Vaterlandsliebe und Hass zu Angst und Trauer: Eine sehenswerte Ausstellung im Dahlemer Museum Europäischer Kulturen erzählt die Gefühlsgeschichte des Ersten Weltkriegs.

Taumel, Trauma, Toleranz: Warum sich 1914 als katastrophische Geburtsstunde Europas lesen lässt.

In Deutschland wurde nach dem Ersten Weltkrieg hart darum gerungen, auf welche Weise man der toten Soldaten würdevoll gedenken sollte. Die überall im Land entstandenen Denkmale erzählen bis heute davon.
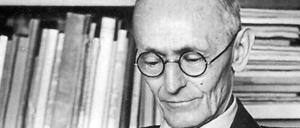
Der Sinn fürs Unzerstörbare: Hermann Hesses Briefe aus den Jahren 1905 bis zu der Zeit kurz vor und während des Ersten Weltkriegs.

Der Großvater hinterließ eine Schachtel mit Fotos, Postkarten und einem verblichenen Militärpass von 1916. Das machte unseren Autor neugierig – und er begab sich nach Frankreich, auf eine Reise in die Vergangenheit.

Alexander Kluge ist mit Filmen berühmt geworden, die Fakten und Fantasie, strenge Wissenschaft und größte Subjektivität miteinander mischen. Nun präsentiert er einen großen Essayfilm über den Ersten Weltkrieg in Berlin.

Aus einer Wohnung dringen Säge- und Klopfgeräusche, die Polizei sucht 1924 nach verschwundenen Männern. Hat Friedrich Haarmann diese alle totgebissen?
öffnet in neuem Tab oder Fenster