
In zwei Jahren verzehnfachte Urania-Direktorin Johanna Sprondel die Besucherzahlen der Urania. Ihr Ziel: Günstige Bildung für alle Berliner. Wegen der Landeskürzung von fast einer Million Euro ist dies nun bedroht.

In zwei Jahren verzehnfachte Urania-Direktorin Johanna Sprondel die Besucherzahlen der Urania. Ihr Ziel: Günstige Bildung für alle Berliner. Wegen der Landeskürzung von fast einer Million Euro ist dies nun bedroht.

Berlin bricht die Hochschulverträge. Die Unis bereiten nun alles für eine Klage vor. TU-Chefin Geraldine Rauch erklärt im Interview, welche Zusagen sie sich wünscht – und warum sie dennoch für Gespräche offen ist.

Noch immer sind Frauen eine Minderheit in Mint-Fächern. Viele von ihnen kämpfen mit männlich dominierten Strukturen, Sexismus und dem Gefühl, sich beweisen zu müssen. Studentinnen berichten.

Kai Wegner (CDU) ignoriere ihre Anfragen zur Kürzungskrise, klagten kürzlich die Berliner Hochschulchefs. Nun ist laut Senatskanzlei ein persönliches Treffen des Regierenden „mit allen relevanten Akteuren“ in der Planung.

Die Arab-German Young Academy bringt Talente aus beiden Kulturräumen zusammen. Sie forschen zu Physik und neuer Technik – und sorgen für ökologische Verbesserungen und Bildungsangeboten in Nahost.

Nach dem Master an der Humboldt-Universität studierte Jonas Piduhn an der Columbia University weiter. Dort bekam er einen Job zwischen den Welten.

Die TU plant einen Neubau für die Physik, der wichtige Zukunftstechnologien voranbringen soll. Bundesmittel sind fest zugesagt. Doch die Finanzverwaltung scheint die Berliner Kofinanzierung zu verweigern.

Die Präsidenten der Berliner Hochschulen brachten im Wissenschaftsausschuss ihre Forderungen an den Senat vor. Den Weg einer Klage wollen sie gehen, sollte es keine Zugeständnisse geben.

Die Berliner Wissenschaft bekommt bis 2027 fast eine Milliarde Euro weniger, es trifft vor allem die Hochschulen. Ina Czyborra (SPD) erklärt, wo sie das Studienangebot verkleinern will und wer geschont wird.

Werner Heisenbergs Memoiren widersprechen historischen Quellen, weist unser Autor nach. Das 100. Jubiläum zur Entstehung der Quantenphysik sollte anders gefeiert werden als geplant. Eine Streitschrift.

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wirft ernste Fragen beim Thema Klimaschutz auf. Experten sind besorgt über seine Pläne, das Pariser Abkommen aufzukündigen und fossile Brennstoffe zu fördern. Es gibt aber auch andere Stimmen.

Ist ästhetisches Kino noch relevant? Der international erfolgreiche Dokumentarfilmer Thomas Riedelsheimer lässt in „Tracing Light“ Physik und Kunst aufeinandertreffen.
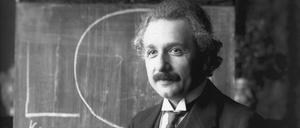
Was hält die Atome zusammen, was ist die Grundlage von Energie und Materie? Vor 100 Jahren änderte sich das Weltbild der Physik radikal. Und Berlin spielte dabei eine große Rolle.

Gibt es sie wirklich, jene geheimnisvolle „Dunkle Energie“, die das Universum immer weiter auseinandertreibt? Einige Astronomen schlagen eine verblüffende neue Erklärung vor.

2025 bekommen die Berliner Hochschulen mindestens 100 Millionen Euro weniger Landeszuschuss als vertraglich vereinbart. Nun prüfen sie eine Klage. Ein Rechtsexperte ordnet die Chancen ein.

Mitten im Zentrum des Reichs leistete ein französischer Kernforscher Widerstand gegen das NS-Regime. Dass er dort leben und forschen konnte, verdankte er einer eigentlich unmöglichen Freundschaft.

Vom Physiker, der schlecht in Physik war, bis zum Chemiker, der seine Meetings im Park abhielt: Um einen Nobelpreis zu bekommen, braucht es manchmal mehr Eigenheiten statt guter Noten.

Impfgegner Robert F. Kennedy hat mehrfach Verschwörungsmythen verbreitet. Nun soll er unter Trump Gesundheitsminister werden. Dagegen gibt es Widerstand.

Physiker der Freien Universität Berlin wollen das Bewusstsein dafür schärfen, dass auch Wissenschaft nicht klimaneutral ist.

„Berlin Quantum“ sollte Berlin zum Forschungshotspot in einer wichtigen Zukunftstechnologie machen. Nun werden die Gelder dafür gestrichen. Das schlägt auch international Wellen.

Die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump war von Wissenschaftsfeindlichkeit geprägt. In seiner zweiten könnte es für die Forschungsfreiheit noch schlimmer kommen.

Sprache, Kunst, Musik: Diese Forschenden erkunden, was unsere Kultur ausmacht, und tragen zu ihr bei. Sie finden Inspiration auf Berliner Straßen, in Museen – und sogar in Schlachtabfällen. Teil neun unserer Serie.

Sie zähmen Algorithmen, lassen Maschinen lernen und bauen die Basis für eine Energiewende. Von den Theoriekniffen dieser Forschenden kann auch die Wirtschaft der Zukunft profitieren. Folge sieben unserer Serie.

Können Anti-Aging-Präparate wirklich die menschliche Lebensspanne verlängern? Der Nobelpreisträger Venki Ramakrishnan erklärt, wie sie wirken und wann handfeste Forschungsergebnisse zu erwarten sind.

Einst wählte Asheville in North Carolina die Demokraten. Doch dann brachte der Tropensturm Helene die landesweit schwerste Verwüstung seit 20 Jahren – und den Wahlkampftross von Donald Trump.

Forschung ist kein Selbstzweck, sondern macht im Idealfall unser Leben besser. Diese Forschenden versuchen das: mit Formeln, fairer KI, einem Grippe-Spray und Energie aus Fäkalien. Folge fünf unserer Serie.

Monatelange Wohnungssuche, unfaire Wohnungsvergabe und Wohnungslosigkeit – das ist die Realität für Studierende in Potsdam. Mit einer Protestaktion plädieren sie für eine gerechte Wohnpolitik.

Der Wirtschaftsnobelpreis geht an Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson. Sie erhalten ihn „für Studien darüber, wie Institutionen entstehen und sich auf den Wohlstand auswirken“.

Proteine sind die Bausteine und Motoren des Lebens. Das Rätsel, wie die Zelle diese Moleküle formt, blieb jahrzehntelang ungelöst. Erst mit Künstlicher Intelligenz kam die Forschung weiter.

Die Forscher John Hopfield und Geoffrey Hinton erhalten den Nobelpreis für ihre Grundlagenforschung. Einer der beiden warnte kürzlich noch davor, dass KI die Menschheit auslöschen könnte.

Der Forscher von der TU Dortmund sucht Alternativen zu Lithium und Cobalt. Aus instabilen Molekülen versucht er, neue Reagenzien zu machen.

Ein Investor entwickelt das Areal in Oberschöneweide, viele Laborflächen sollen entstehen. Mancher träumt von einem Hotspot der Biotechnologie- und Medizinbranche. Wird Berlin zum „Boston an der Spree“? Ein Besuch.

Die neue KI „o1“ des ChatGPT-Entwicklers soll komplexe Probleme besser lösen als bisherige Varianten. OpenAI versucht dabei, dem menschlichen Denken näherzukommen. Das hat Vor- und Nachteile.

Marode Schulen und Kinder, die Mindeststandards nicht erfüllen: Es könnte kaum schlimmer laufen. Experte Warnke erklärt, was besser gemacht werden könnte – und warum das nicht passiert.

Das Otto-Suhr-Institut an der FU feiert Jubiläum. Nicht wenige, die hier Politologie studierten, wurden zu Protagonisten der West-Berliner Nachkriegsgeschichte.

Ulf Höpfner engagiert sich in der AG Schwule Lehrer der GEW. Seit deren Gründung 1978 hat sich vieles geändert – doch Anfeindungen bleiben ein Problem.

Ein italienisch-chinesisches Forscherteam behauptet: Wir haben schon längst Dunkle Materie aufgefangen. Die meisten ihrer Kollegen können das jedoch kaum glauben. Bald wird sich zeigen, wer recht hat.

Synthetische Diamanten werden mittlerweile in Massen hergestellt und verändern Wissenschaft und Industrie – und den Markt für Juwelen.

Ein Aktivist hungert seit 77 Tagen und will künftig auch keinen Saft mehr konsumieren. Er fordert eine Regierungserklärung zur Klimakatastrophe. Die Kampagne bekommt Unterstützung aus der Politik.

Kürzlich ist auf Netflix die Serie „3 Body Problem“ erschienen, die „Hard Science Fiction“ sein möchte, also wissenschaftliche Akkuratheit beachtet. Aber was ist tatsächlich Fakt – und was Fiktion?
öffnet in neuem Tab oder Fenster