
Die Bundesforschungsministerin will die Wissenschaft mit „sicherheitspolitischen Interessen in Einklang“ bringen. Droht die Forschung politisch vereinnahmt zu werden? Ein Gespräch mit der Historikerin Carola Sachse.

Die Bundesforschungsministerin will die Wissenschaft mit „sicherheitspolitischen Interessen in Einklang“ bringen. Droht die Forschung politisch vereinnahmt zu werden? Ein Gespräch mit der Historikerin Carola Sachse.

Die Forschenden unserer zehnteiligen Serie richten zwar alle den Blick nach vorn. Doch manchen sind konkrete Zukunftsideen zum Greifen nahe. Teil 2 unserer Serie.

Gender Pay Gap oder die Folgen der Pille: Frauen werden am Arbeitsmarkt oft benachteiligt, was bislang kaum systematisch erforscht war. Harvard-Ökonomin Claudia Goldin hat das geändert.

Die Ökonomin wird für ihre Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt ausgezeichnet. Der Preis ist mit 950.000 Euro dotiert.

Drei Forscher erhalten die renommierte Auszeichnung in diesem Jahr. Ihre Namen waren schon Stunden vor der Verkündung in Stockholm durch Medienberichte bekannt geworden.

Den drei Wissenschaftlern ist es gelungen, Laserpulse zu erzeugen, die nur Trillionstel einer Sekunde lang sind. Einer von ihnen, Ferenc Krausz, forscht am deutschen Max-Planck-Institut.

Anfang Oktober teilt die Schwedische Akademie der Wissenschaften mit, wer dieses Jahr ausgezeichnet wird. Drei Tagesspiegel-Autoren geben ihre Einschätzung ab.

Ungewöhnliche Wetterbedingungen haben in diesem Sommer den Abwärtstrend des arktischen Meereises gebremst. Ein langfristiger Stopp der Eisschmelze ist nach Ansicht der Polarforscher aber unwahrscheinlich.

Der chinesische Autor Liu Cixin wurde mit einem Roman über den Erstkontakt mit Aliens bekannt. Kurz danach stellte China das weltgrößte Radioteleskop fertig – für ebendiesen Zweck.

Kann es einen chinesischen Alexander von Humboldt geben? fragt der Romanist Ottmar Ette – und baut ein Forschungszentrum in Changsha auf.

Im kommenden Jahr wird das Gebäude 100 Jahre alt. Aber schon am Dienstag findet ein Festakt für das Wahrzeichen des Telegrafenbergs statt – nach monatelanger Schließung.

Sind wir allein im Universum? Im Jahr 1994 kamen zwei Astronomen einer Antwort auf diese Frage ein Stück näher.

Spione und aufmerksame Physiker informieren Josef Stalin schon früh über das eigentlich geheime Atombomben-Forschungsprogramm der USA. Die UdSSR ging in die Offensive und zündet nur wenige Jahre später ihre eigene Atombombe.

Das Gelände des Kernkraftwerks ist nach der Reaktor-Katastrophe noch immer verstrahlt. Ukrainische Wissenschaftler wollen diese Strahlung für die Forschung nutzen – etwa für die Raumfahrt.

Die Auffassung, Fortschritt hänge mit Konsum zusammen, muss sich ändern, sagt Celeste Saulo. Die designierte Chefmeteorologin der UN über Waldbrände, Frühwarnsysteme und das Glück der geteilten Freude.

Der Wissenschaftshistoriker Dieter Hoffmann hat die Abhörprotokolle deutscher Physiker im englischen Farm Hall vollständig ediert

Im Zeitalter des Artensterbens stoßen Forschende auf bislang unbekannte Spezies, die noch existieren könnten – aber bereits ausgestorben sind. „Dark Extinction“ nennen sie das beunruhigende Phänomen

Ein Forschungsteam will ein Material entdeckt haben, das bei Raumtemperatur ohne Verluste Strom leitet. Inzwischen hat die Fachwelt es kritisch geprüft. Ist es nun ein Supraleiter oder nicht?

Im Jahr 1909 erhält Guglielmo Marconi den Nobelpreis für die Erfindung des Radios. Doch aus Großbritannien kommt Kritik: Andere sollen vor ihm darauf gekommen sein.

Mit dem Blockbuster „2012“ produzierte Roland Emmerich nach seinen Worten die „Mutter aller Zerstörungsfilme“. Der Film basierte auf einer uralten Prophezeiung der Maya – die es in Wahrheit nie gegeben hat.

Christopher Nolans Film „Oppenheimer“ ist hochaktuell: Unsere Existenz könnte durch Künstliche Intelligenz bedroht sein, wie einst durch die Atombombe. Über die Frage der Verantwortung.

Giorgio Parisi erhielt 2021 den Nobelpreis, weil er komplexe Systeme zähmte. Der theoretische Physiker über Science-Fiction, das Flugverhalten von Staren und wie er aus Versehen italienische Köche erzürnte.
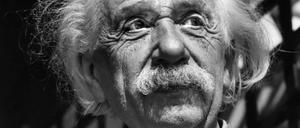
1939 erfährt der Physiker Leó Szilárd, dass die Nazis bald Atombomben besitzen könnten. Gemeinsam mit Albert Einstein überzeugt er Präsident Roosevelt, ihnen zuvorzukommen – und bereut seine Entscheidung am Ende fürchterlich.
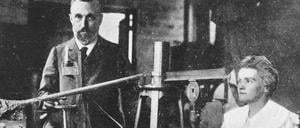
Die junge Marie Curie sucht ein Thema für ihre Dissertation – und prägt mit ihrem Mann den Begriff Radioaktivität. Ihr neu entdecktes, radioaktives Element benennen sie nach ihrer Heimat.

Mohammad-Taha Abdollahnia hat beim Abitur am Herder-Gymnasium in Berlin-Westend die Maximalpunktzahl geholt. Hier spricht er über seinen Lieblingslehrer, sein Verhältnis zu Noten und ein Treffen mit dem Bundespräsidenten.

Der sowjetische Physiker Anatoli Bugorski ist der einzige Mensch, der je vom Protonenstrahl eines Teilchenbeschleunigers durchdrungen wurde – und überlebte.

Eine hauchdünnen Schicht Perowskit auf einer dicken Schicht Silizium ist die Revolution in der Fotovoltaik. Die neue Solarzelle ist nicht nur besser, sie könnte auch die Abhängigkeit von China beenden.

Der ambitionierte Wissenschaftskommunikator Jens Foell ist Teil von Mai Thi Nguyen-Kims Team. Sein erstes Buch begeistert mit spannendem Wissen und leichtfüßigen Erklärungen.

Vielen Forschenden ist nicht bewusst, wie viel klimaschädliche Emissionen die Wissenschaft produziert. Der Quantenphysiker Jens Eisert von der FU Berlin will das ändern.

Annabella Rauscher-Scheibe ist seit kurzem Präsidentin der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Hier spricht sie über ihre Pläne, Gefahren für den Standort Berlin – und Studierende ohne Lobby.

Die Wissenschaftseinrichtungen auf dem Potsdamer Telegrafenberg laden am Samstagabend ein zu Entdeckungen und Mitmachaktionen – auch eine Live-Schalte nach Spitzbergen ist geplant.

Fast 1500 Lehrkräftestellen konnten in Berlin zuletzt nicht mehr besetzt werden. Senatorin Ina Czyborra macht nun Hoffnung auf eine Linderung des Lehrermangels.

Als Theodore Maiman den ersten Laser in Betrieb nahm, wusste noch niemand, wozu er gut ist. Heute ist er ein essenzielles Werkzeug in Medizin, Industrie und Forschung.

2500 Absolventen pro Jahr für das Berliner Lehramt: Darauf hat sich die Koalition geeinigt. Erreichen könne man es nicht vor 2029, sagt Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra.

Knobelaufgaben für Kakadus, Rätselspaß für Roboter – durch die erstaunlichen Fähigkeiten von Tieren und die Fehler von KI lernt die Forschung menschliche Intelligenz zu verstehen.

Der bekannte Wettermoderator Sven Plöger hat ein neues Buch veröffentlicht. Im Gespräch ruft er zu mehr Klimaschutz auf, spricht über Chancen der Krise und seine persönliche „Taxiregel“.

Der Künstler Itamar Gov wirft in Berlin einen kritischen Blick auf technologischen Fortschritt und Wissenschaft. Sein Ausgangspunkt: ein Selbstmord.

Massive Sonneneruptionen gefährden die Infrastruktur auf der Erde, insbesondere Stromleitungen und Satelliten. Das zeigt, wie verwundbar die moderne Gesellschaft ist.

24 Jahre war Mechthild Koreuber in ihrem Amt an der Freien Universität – ein Gespräch über Möglichkeiten, Erfolge und Herausforderungen.

In Folge sieben unserer Serie präsentieren wir erneut zehn wichtige Köpfe aus der Berliner Wirtschaft. Diesmal im Fokus: Irene Selvanathan, deren Projekte ziemlich „abgefahren“ sind.
öffnet in neuem Tab oder Fenster