
Thomas Emmrich war eines der größten Tennis-Talente seiner Zeit. Eine ZDF-Doku zeigt, wie die DDR seine Karriere mit allen Mitteln stoppte, bevor sie richtig begann.

Thomas Emmrich war eines der größten Tennis-Talente seiner Zeit. Eine ZDF-Doku zeigt, wie die DDR seine Karriere mit allen Mitteln stoppte, bevor sie richtig begann.

Jack White war einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Nun starb er mit 85 Jahren. Promis wie Carmen Geiss und Hansi Hinterseer reagieren bestürzt auf den Tod und teilen Erinnerungen.

Das historische Kino Capitol Dahlem steht vor dem Aus. Die FU Berlin plant aufgrund von Sparmaßnahmen den Verkauf des Grundstücks. Doch Bezirk und Kinobetreiber leisten Widerstand.

Unser Leser, selbst Spieler und Trainer, trauert um die nach 102 Jahren eingestellte „Fußball-Woche“ – und kritisiert den Berliner Fußball-Verband wie auch die Politik. Und wie sehen Sie’s?

Er wurde vor allem als profilierter Berliner Theaterkritiker gewürdigt. Doch Walther Karsch, der vor 80 Jahren den Tagesspiegel mitgründete, war mehr als das.

Der Weg zur friedlichen Revolution und dem Fall der Mauer 1989 war lang. Manche einzelne Schritte sind schon vergessen. Eine Ausstellung in Berlin soll an Widerstand und Opposition erinnern.

Charlottenburg-Wilmersdorf wirbt vor allem mit Kultur, historischen Orten sowie den vielen Läden und Lokalen. Eine beauftragte PR-Agentur hat Bürger aus dem Bezirk an der Vorbereitung der Kampagne beteiligt.

Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Hessenwinkel in Berlin-Rahnsdorf sollen hunderte Wohnungen entstehen. In der Nachbarschaft stößt das auf Widerstand.

Um den neuen Straßennamensgeber in Berlin-Mitte gibt es einmal mehr eine Debatte. Ein wichtiges Detail seiner Biografie ist dabei wohl meist falsch wiedergegeben worden.

Die Berliner Künstlerin Maria Eichhorn nutzte den an sie verliehenen Käthe-Kollwitz-Preis dazu, um zu einem vernachlässigten Denkmal zu recherchieren. Akademie der Künste und Stadt wollen sich nun kümmern.

Von den Nazis verfemt, dann zufällig wiederentdeckt. Die als „entartet“ diffamierten Skulpturen der Moderne, die 2010 als Sensationsfund um die Welt gingen, sind wieder in Berlin zu sehen.

Ob Kreis- oder Bundesliga, die „Fußball-Woche“ berichtete seit 1923 immer mit viel Herzblut. Das Fachblatt war integraler Bestandteil der Berliner Fußballkultur – und wird eine riesige Lücke hinterlassen.

Seit Jahren soll das ehemalige Sporthotel in Berlin-Hohenschönhausen abgerissen werden. Doch die Bauruine steht immer noch. Bilder aus dem Inneren zeigen den Verfall.

In der Debatte zur ungeliebten Hauptstadt appelliert unsere Leserin an ihre Mit-Berliner, erinnert an frühere Zeiten in Ost wie West – und schickt ein Gedicht.

Die Galerie Gräfe Art Concept zeigt Landschaften, Porträts und Skizzen der großen Künstlerin, die den Typus der Neuen Frau in Berlin verkörperte und 1937 nach Schweden floh.
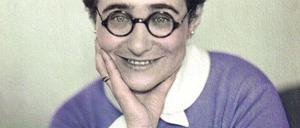
Sie schrieb „Liebeserklärungen an diese Stadt“, doch Gabriele Tergit musste vor den Nazis fliehen. Zu Besuch kam sie später zurück, lebte aber in London. Jetzt erinnert eine Gedenktafel an die Schriftstellerin und Journalistin.

Der Spandauer Verein hat eine spannende Historie und interessante Termine in der Zukunft: Gala in der Zitadelle, Baustart der neuen Kabinen. Und dann naht auch noch das Derby.

Vom verrußten Problembau zur Traumkulisse für Hochzeiten, Lesungen und Konzerte: Der Labsaal lebt auf, weil Berliner sich an ein schwieriges Vorhaben wagten. Was machen sie richtig?

Gabriele Tergit ist für ihre Romane und Gerichtsreportagen bekannt und schrieb nach dem Krieg für den Tagesspiegel. Den Nationalsozialisten war sie nur knapp entkommen.

Zeitreise mit dem Stuhlkreis: Die Berliner Künstlerin Luise Schröder präsentiert die fotografischen Ergebnisse ihrer Recherchen in Archiven der DDR-Opposition.

Zum Geburtstag des früheren Tagesspiegel-Verlegers Franz Karl Maier veröffentlichen wir hier noch einmal seinen Artikel vom 23. März 1983, genau 50 Jahre nach dem „schwärzesten Tag in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus“.

Der Einheitsmonitor zeigt: Noch gibt es zu viele Regionen im Osten, die sich nicht ausreichend wahrgenommen fühlen. In ihnen entscheidet sich, ob das Gemeinsame wirklich gelingt.

Zeitungsgründer Erik Reger erinnert ungeduldige Deutsche daran, wie geduldig sie mit Hitler, Göring und Goebbels waren und wie viel besser sie es jetzt schon haben als im Krieg.

Unser Redakteur antwortet auf eine Leser-Kritik zur Jubiläumsausgabe, die zu wenig Historisches geboten habe. Und wie sehen Sie’s?

Unser Leser hätte im Schwerpunkt zu 80 Jahren Tagesspiegel gern mehr über besondere Ereignisse und profilierte Köpfe der Zeitungsgeschichte gelesen, aber fand auch Interessantes. Und wie sehen Sie’s?

Unser Leser engagiert sich in der Berliner Geschichtswerkstatt und kritisiert den Plan des Berliner Senats. Er hat eine andere Idee zur Ehrung des Altkanzlers. Und wie sehen Sie’s?

Am Freitag feiert Deutschland seine Einheit. Eine repräsentative Umfrage zeigt, ob Ost und West bei Löhnen, Vermögen und Repräsentation mehr trennt als eint.

Die Treitschkestraße in Steglitz-Zehlendorf war nach einem Antisemiten benannt. Nun hat sie einen neuen Namen bekommen – nach langer Debatte.

Die Ausstellung „Cold War Games“ im Berliner Alliiertenmuseum zeigt, wie sich Krieg und Spiele seit den 1950er Jahren wechselseitig beeinflussten.

Unwürdige Zustände und Rundum-Überwachung waren in der berüchtigten Berliner Psychiatrie für Straftäter normal. Die Rolle der Stasi im Haus wird aber verkannt, erklärt nun ein Forscher im Gespräch.

Im Frühjahr gingen die Turmuhren kurzzeitig richtig. Doch inzwischen tickt das Wahrzeichen wieder falsch. Wann naht Abhilfe? Und was hat der Eigentümer mit dem Rest des Kasino-Gebäudes vor?

Die Weltraumforscherin aus Schöneberg nahm eine Miniaturnachbildung der Freiheitsglocke mit ins All. Nun hat sie das Original zum Jubiläum des Glockenschlags mit dem Regierenden und dem Bezirksbürgermeister besucht.

Ein Trio aus einer Stadt in der Zweiten Liga ist in der Historie der Spielklasse die absolute Ausnahme. Vor 50 Jahren gab es das zum ersten Mal. Die Berliner Klubs schrieben dabei völlig unterschiedliche Geschichten.

Von Marlene Dietrichs Kleidern bis zu Nosferatus Gruseluhr: Vor einem Jahr schloss das Filmmuseum am Potsdamer Platz. Die Archivierung der zahlreichen Exponate ist nun abgeschlossen.

Reisen aus dem geteilten Berlin war lange schwierig und streng reglementiert. Welche Routen nahmen Menschen auf sich, um an ihre Sehnsuchtsorte zu gelangen?

20 Jahre ist er tot: Jetzt bekommt Harald Juhnke endlich einen Platz am Kurfürstendamm. Zu Recht, findet unser Autor. Auch wenn sein Lebenswandel nicht immer vorbildlich war.

„Wir auf dem Lande...“ So stieg Zeitungsgründer Erik Reger 1945, als er noch in Mahlow im Süden Berlins lebte, in der ersten Tagesspiegel-Ausgabe in seine Gartenkolumne ein – verfasst unter dem Pseudonym „Campester“.

Zum Geburtstag unserer Zeitung hier ein kurzer Blick ins Kleinteilige – auf die Berlin-Seite, eine von vier Seiten insgesamt am 27. September 1945.

Zwischen den Systemen: Horst Strempels Werk „Das Referat“ entstand 1945, im Gründungsjahr des Tagesspiegels. Es zeigt den Aufbruch, doch wenige Jahre später musste der Künstler nach West-Berlin fliehen. Eine Spurensuche.

Die Chefredaktion hat die Leserinnen und Leser des Tagesspiegels aufgerufen, Fragen zu schicken. Hier eine Auswahl.
öffnet in neuem Tab oder Fenster