
Ab Frühjahr 2027 sind Pergamonaltar und Nordflügel wieder zu besichtigen. Anlässlich der Vollendung des ersten Bauabschnitts lud die Preußenstiftung zum ersten Rundgang ein.

Ab Frühjahr 2027 sind Pergamonaltar und Nordflügel wieder zu besichtigen. Anlässlich der Vollendung des ersten Bauabschnitts lud die Preußenstiftung zum ersten Rundgang ein.

Der Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen kostete allein im Nachbarland mehr als fünf Millionen Menschen das Leben. Für die Erinnerung an deren Schicksal soll es in Berlin einen festen Ort geben.

Fast 70 Pflichtspiele gab es bisher zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern. Vor dem Pokal-Achtelfinale blicken wir auf elf besondere Duelle zurück.

Im Februar 2005 wurde Hatun Sürücü von ihrem Bruder erschossen, weil sie ein freies Leben führen wollte. Jetzt spricht ihr Sohn über seine Kindheit in Berlin und den Mord an ihr.

Jede Woche stellen wir Routen vor, mit denen sich 10.000 Schritte pro Tag ganz einfach erreichen lassen. Diesmal geht es vorbei an Pilzen, Weihnachtsbeleuchtung und Cafés durch die City West.

TeBe gilt als jüdisch geprägter Verein. Aber wie handelte der Berliner Klub direkt nach der Machtergreifung der Nazis? Ein neues Buch gibt Antworten.

Chaotisch ging es zu, als die Krankheit Aids für Angst und Verzweiflung sorgte. Inmitten dieser Turbulenzen gründete sich 1985 die Berliner Aids-Hilfe. Eine Gala erinnert daran.

Der Louvre in Paris erhöht seine Eintrittspreise für Nicht-Europäer. Trump will Nicht-Amerikaner in den Nationalparks mehr zahlen lassen. Was Berlin davon lernen kann.

Vor 50 Jahren starb Hannah Arendt. An der Freien Universität wird seit 2018 die Kritische Gesamtausgabe ihres Werks ediert und auch digital veröffentlicht.

Zur Abschiedsfeier war der Hangar voll: Politik und Rettungsorganisationen zollten „Christoph 31“ Respekt. Der Flieger hat Berliner Geschichte geschrieben.

Über die Nutzung des früheren Erlebnisbads in Friedrichshain ist lange gestritten worden. Auf dem SEZ-Areal sollen Wohnungen gebaut werden. Protestierende stellten Strafanzeige, der Bezirk schaltet sich ein.

Die Galerien in Charlottenburg organisieren einen langen Samstag. Diesmal feiern sie das Jubiläum von Carsta Zellermayer und die Neugründung der Iros Gallery.

Unsere Leserin zog einst ohne Deutschkenntnisse aus England nach Berlin. Kolumnist Günter Matthes war für sie „mein Lehrer beim Tagesspiegel“. Und was sind Ihre Erinnerungen?

Nach sechs Jahren Sanierung wird die Gruft im Berliner Dom im Februar wiedereröffnet. 91 kostbare Sarkophage sind in eine der bedeutendsten dynastischen Grablegen Europas zurückgekehrt.

Auch um die West-Berliner S-Bahn verdient gemacht: Unser Leser weist auf einen weiteren Aspekt der Arbeit des Tagesspiegel-Lokalchefs hin, der vor 30 Jahren starb. Und wie sehen Sie’s?

Özgür Özvatan hatte den Antrag für den Verband eingebracht. Der BFV-Vizepräsident spricht über die hitzige Debatte und die aus der Ablehnung resultierenden Folgen.

Mehr als 100 Jahre wurde in einem Backsteinhaus in Berlin-Dahlem zu Zellaufbau, Züchtung und Erbgut der Pflanzenwelt geforscht. Jetzt wurde das Institut für Pflanzenphysiologie der Freien Universität aufgelöst.

In Berlin spielt die koloniale Vergangenheit mehr als in jeder anderen Stadt Deutschlands eine Rolle. Heute erinnert fast nichts mehr daran. Der Ausstellungskurator Ibou Diop erklärt, was sich am Umgang mit ihr ändern muss.

Vor 66 Jahren wurde die Kult-Figur mit Spitzbart in Berlin-Mahlsdorf erfunden, seitdem hat sie Generationen von Kindern beim Einschlafen begleitet. Jetzt könnte sie eine besondere Auszeichnung bekommen.

Mit einer Live-Folge vor Publikum hat Hertha Base auf die eigene Vergangenheit zurückgeblickt. Der Podcast war der Chronist einer aufregenden Zeit für Hertha BSC.

Der Bildhauer Emilio Vedova kam als Gaststipendiat nach Berlin und ließ sich ausgerechnet im ehemaligen Atelier von Arno Breker nieder. Dort schuf er gewaltige Skulpturen.

Der Literatur-Salon Potsdamer Straße lädt zu Kiez-Veranstaltungen, mit denen sich die Wiederentdeckung Adelbert von Chamissos fortsetzt. Auch sein Grab wurde restauriert.

Seit einem Dreivierteljahrhundert werden an der Eisler-Hochschule Musiker und Sänger ausgebildet. Dass sie früh den Kontakt zum Publikum suchen, hat für Berliner einen großen Vorteil.

Die Sophiensäle waren einst ein Vereinshaus, sind heute Theaterort und Kulturstätte. Und anders als andere hielt man dort an dem Gebäude fest. Ein großer Vorteil.

Unsere Leserinnen, in der „Mendelssohn-Remise“ im Berlin-Mitte ehrenamtlich tätig, sind empört über die Vorgehensweise des Senats.

Ben de Biel schoss im Club Ritter Butzke zwischen 2009 und 2016 über 40.000 Fotos. Die Ausstellung „Elegantly Wasted“ zeigt eine Auswahl. Die Bilder wirken wie aus einer völlig anderen Zeit.
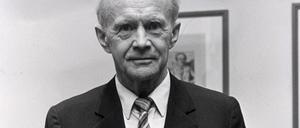
Nachruf, Reaktionen, letzter Artikel, beispielhafte Folge „Am Rande bemerkt“: Wie die Berlin-Redaktion an ihren langjährigen Leiter und Kolumnisten erinnerte.

Das Aleppo-Zimmer ist eines der Highlights der Museumsinsel, derzeit wird es neu eingerichtet. Die Besucher dürfen sich im sanierten Welterbe auf Überraschungen einstellen.

Einst letzte Festung der deutschen Klassik, heute verwahrloste Toplage: Ein Buch zeigt, wie herrschaftlich Karl Friedrich Schinkel in der Bauakademie lebte.

Auch in scheinbar banalen Alltagsdingen steckt jede Menge Historie. Zum Beispiel in sechs ausgewählten Objekten aus den Museumsdepots – vom Henkersbeil bis zur Zigarettendose.

Jede Woche stellen wir Routen vor, mit denen sich die 10.000 Schritte ganz leicht erreichen lassen. Der perfekte Abendspaziergang führt vom Postfuhramt Richtung Schloss Bellevue – und zeigt, wie nah Stadttrubel und Stille sich sein können.

Ilka Vierkant ist Enkelin eines Bahndirektors, der möglicherweise Routen für Juden-Deportationen plante. Nach der Begegnung mit Holocaust-Überlebenden schrieb die Schauspielerin ein Theaterstück, das berührt.

Der Rasthof Avus liegt wie eine Insel zwischen den vielen Spuren der A 115 und der A 100, Deutschlands meistbefahrener Autobahn. Eine Nacht inmitten des Asphalts.

Die ersten Gebäudegestaltungen für Berlins historische Mitte stehen fest. Die Entwürfe wirken stilistisch zusammengewürfelt – und sind teuer.

Am 19. Dezember 2016 rast der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Laster auf einen Berliner Weihnachtsmarkt und tötet elf Menschen. 3sat lässt Überlebende, Angehörige und Ermittler sprechen.

1918, 1945, 1989: Ausgehend von einem wiederveröffentlichten Tagesspiegel-Leitartikel aus der Nachkriegszeit schreibt unser Leser über Mauerfall und Wiedervereinigung. Und wie sehen Sie’s?

Sie wurde 97 Jahre alt: Ingeborg Schütz, die kleine, starke Wirtin des zentralen Dorftreffs in Berlin-Kladow. An ihrer Kneipe zog ein deutsches Leben vorbei. Ein Nachruf.

Sie sind zwischen 98 und 101 Jahren und wollen reden: über ihre Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg, über Freiheit und Demokratie. Hunderte Grundschulkinder hörten zu.

Der Literatur-Salon Potsdamer Straße lädt zu Kiez-Veranstaltungen, mit denen sich die Wiederentdeckung Adelbert von Chamissos fortsetzt. Auch sein Grab wurde restauriert.

Unser Leser hatte eine Alternative zur Hofjägerallee vorgeschlagen und kritisiert, dass der zuständige Bezirk übergangen werde. Hier nun Kai Wegners Replik – und sein Lob der Debattenkultur.
öffnet in neuem Tab oder Fenster